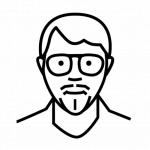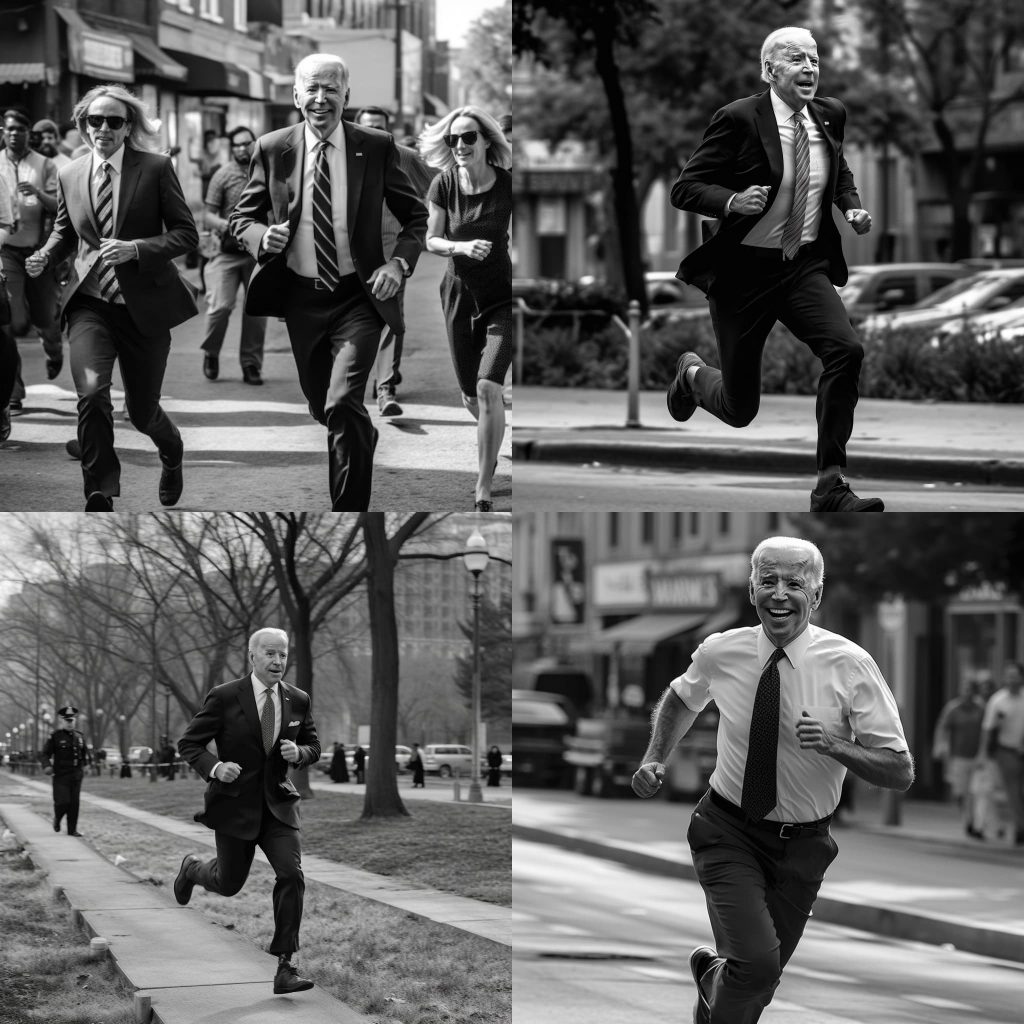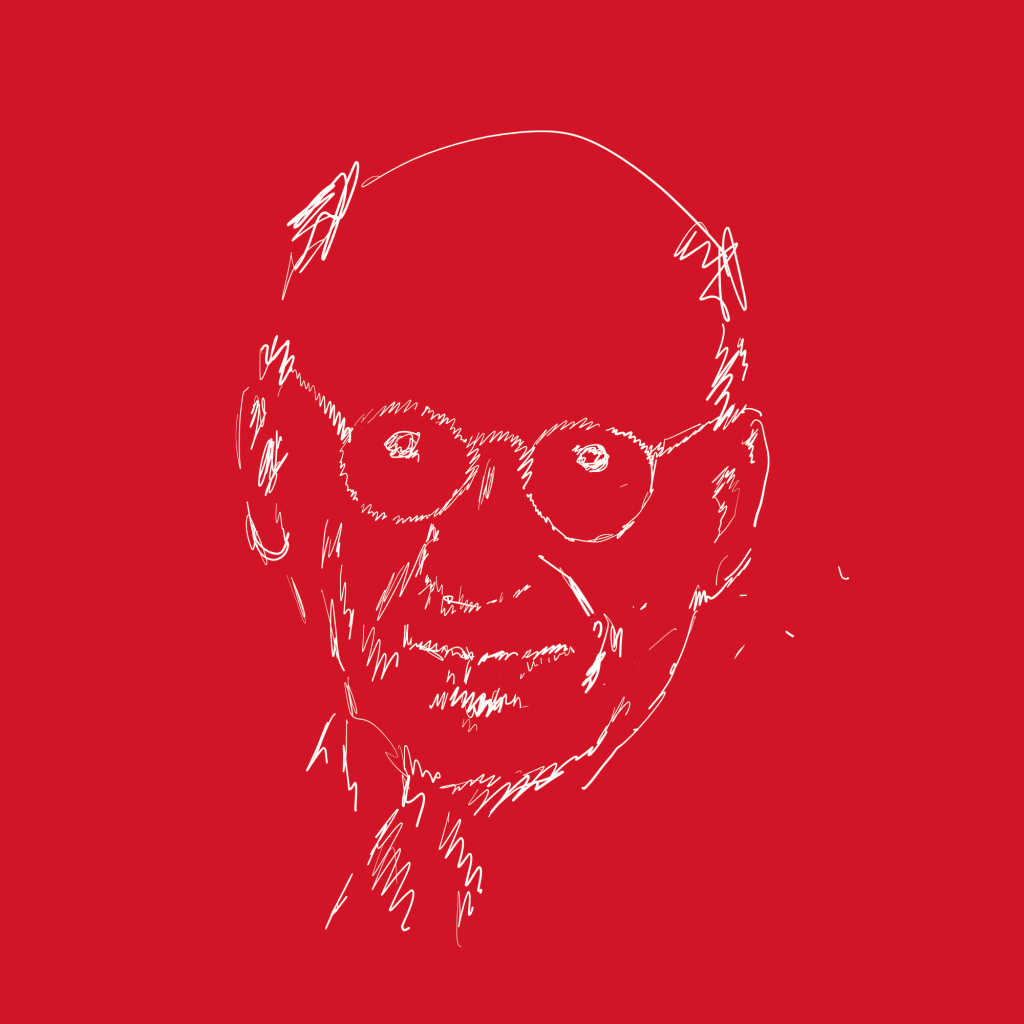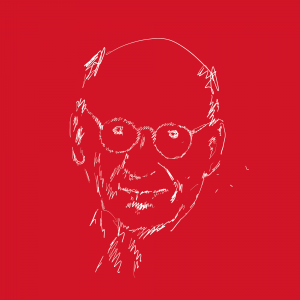Ästhetik und Rythmus
Wir haben ein gutes Gefühl, wenn wir bestimmte Inhalte oder Merkmale mühelos und schnell verarbeiten. Die Mühelosigkeit des Verarbeitungsvorganges löst selbst, zusätzlich zu den Inhalten, emotionale Reaktionen aus. Da der menschliche Sinnesapparat und das Gehirn Produkte der Evolution sind, sind sie auf überlebensrelevante Stimuli zugeschnitten. Die passenden Reize werden schnell und mühelos verarbeitet und deshalb als ästhetisch empfunden: Das Gehirn „mag“ Symmetrie, Kontraste und Redundanzen, da diese den Anforderungen des sensorischen und kognitiven Apparates entsprechen. Man könnte also sagen, dass das Gehirn „faul“ ist, und eine Vorliebe für all jene Dinge hat, die wenig aufwendig in der Verarbeitung sind. Die menschliche Strukturerwartung führt dazu, dass wir leicht zu erkennende Muster besonders dankbar annehmen. Ambitioniertere Zeitgenossen können sich aber auch leicht unterfordert fühlen. Sie sind auf etwas schwerer zu erkennende Muster aus, die sie dann für komplex und sich für besonders distinguiert halten. Die Musik und auch das Design, die Kunst und die Werbung tragen diesen Vorlieben Rechnung indem sie ihre Inhalte entsprechend strukturieren. Wir orientieren wir uns auch nicht gern an abstrakten Kategorien, sondern verwenden zum Vergleich lieber einen „objektiven“ Prototypen. Für die von Eleanor Rosch (1973) inspirierte Prototypen-Theorie wird als Beispiel gerne die Gesichtserkennung herangezogen, wobei das Gedächtnis ein Gesicht als Abweichungen von einem Durchschnittsgesicht – also einem Prototypen, einem Mittelmaß – speichert.
Siehe dazu auch: Evolutionäre Ästhetik / Clemens Schwender, Benjamin P. Lange & Sascha Schwarz (Hrsg.)